Oberverwaltungsgericht Niedersachsen
Urt. v. 14.02.2023, Az.: 12 KS 133/21
Anlagenschutzbereich; Bundeswehr; immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid; (Erfolgreiche) Klage der Bundeswehr gegen immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid für Windenergieanlagen (WEA)
Bibliographie
- Gericht
- OVG Niedersachsen
- Datum
- 14.02.2023
- Aktenzeichen
- 12 KS 133/21
- Entscheidungsform
- Urteil
- Referenz
- WKRS 2023, 12871
- Entscheidungsname
- [keine Angabe]
- ECLI
- ECLI:DE:OVGNI:2023:0214.12KS133.21.00
Rechtsgrundlagen
- BImSchG § 9
- LuftVG § 12
- LuftVG § 14
- LuftVG § 18a
- LuftVG § 30 Abs. 2
Fundstellen
- BauR 2023, 1095-1100
- DÖV 2023, 566
- NordÖR 2023, 281-287
Amtlicher Leitsatz
- 1.
Die luftverkehrsrechtliche Zulässigkeit einer im Anlagenschutzbereich einer militärischen Flugsicherungsanlage gelegenen WEA (mit einer Gesamthöhe von mehr als 100 m) darf von der Immissionsschutzbehörde nicht ohne die nach §§ 18a, 30 Abs. 2 Satz 4 ff. LuftVG erforderliche (positive) Entscheidung der Bundeswehr bejaht werden.
- 2.
Eine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 2 LuftVG kann in entsprechender Anwendung des § 48 VwVfG aufgehoben werden.
Tenor:
Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, wird das Verfahren eingestellt. Im Übrigen wird der Teilabhilfebescheid des Beklagten vom 3. Februar 2021 aufgehoben.
Der Beklagte und die Beigeladene zu 1) tragen die Kosten des Verfahrens je zur Hälfte; ausgenommen sind die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese jeweils selbst tragen.
Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.
Der jeweilige Vollstreckungsschuldner kann die vorläufige Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des auf Grund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger zuvor Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Die Klägerin (Bundeswehr) wendet sich gegen den vom Beklagten der Beigeladenen zu 1) erteilten immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid vom 3. Februar 2021, mit dem er der Letztgenannten die "angefragte luftfahrtrechtliche Genehmigungsfähigkeit" von zwei Windenergieanlagen (= WEA) mit den Nummern 1 und 4 bescheinigte.
Die Beigeladene zu 1) plante den Betrieb von insgesamt fünf WEA mit einer Gesamthöhe von knapp 200 m, und zwar in einem bzw. am Rande eines - östlich des Truppenübungsplatzes Munster (Nord) gelegenen - Gebiet(s), das von ihr als sog. Windpark Schatensen bezeichnet wird und in dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2019 des Beklagten (= RROP 2019) als Vorranggebiet für die Windenergienutzung ausgewiesen war (s. folgende Karte). Mit Urteil vom 8. Februar 2022 (- 12 KN 51/20 -) erklärte der Senat die windkraftbezogenen Festlegungen in dem RROP 2019 u. a. deshalb für unwirksam, weil die entsprechenden Vorranggebiete überwiegend in Korridoren für Hubschraubertiefflüge lagen und deren genauer Verlauf sowie eine Zustimmung der Bundeswehr zur Verwirklichung von WEA offen waren.
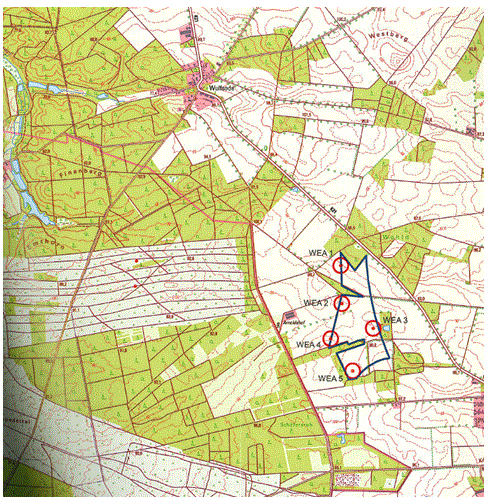
Dementsprechend hatte die Bundeswehr einer mit der Beigeladenen zu 1) verbundenen Gesellschaft auf eine informelle Voranfrage zur Verwirklichung von - damals noch sieben, größeren - WEA in dem Windpark Schatensen bereits mit Schreiben vom 15. April 2019 mitgeteilt, dass die Anlagen unter mehreren militärischen Gesichtspunkten Belange der Bundeswehr berührten. Denn sie liegen danach
- in der sog. Emissionsschutzzone des Truppenübungsplatzes Munster
- im Verlauf eines Korridors für den Hubschraubertiefflug (flugbetriebliche Bedenken)
- im Zuständigkeitsbereich des Militärflugplatzes Faßberg (§ 14 LuftVG - flugbetriebliche Bedenken)
- im Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung dieses Flugplatzes (§ 18a LuftVG) sowie
- im Bereich des Interessengebiets der Luftverteidigungsradaranlage Visselhövede und einer militärischen Funkstelle.
Bei Verwirklichung der WEA würde der für den Flugbetrieb mit unbemannten Aufklärungssystemen nutzbare Teil des Truppenübungsplatzes Munster-Nord erheblich reduziert. Weiterhin ergäben sich Einwände gemäß § 14 LuftVG, da sich die geplanten WEA innerhalb des drei km breiten Sicherheitskorridors einer Nachttiefflugstrecke befinden würden. Dem Vorhaben könne deshalb in dieser Form nicht zugestimmt werden.
Um möglichst kostengünstig Planungssicherheit zu erlangen, beantragte die Beigeladene zu 1) im Juli 2019 beim Beklagten einen immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid "auf Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzung hinsichtlich der luftverkehrsrechtlichen Belange" für fünf WEA, deren Lage sich aus der o. a. Karte ergibt, mit einer Gesamthöhe von jeweils knapp 200 m. Dem Antrag waren neben dem vorbezeichneten Schreiben der Bundeswehr vom 15. April 2019 sowie Lageplänen (nur) noch sog. anlagenspezifische Unterlagen zur luftverkehrsrechtlichen Beurteilung beigefügt, darunter ein an die Beigeladene zu 2) gerichteter Antrag auf Zustimmung nach §§ 12 ff. LuftVG, den der Beklagte unter dem 26. Juli 2019 an diese weiterleitete. Zugleich wurde von ihm auch das nunmehr die Klägerin vertretende A. (Bundesamt) um Stellungnahme gebeten.
Unter dem 30. August 2019 - beim Beklagten eingegangen am 4. September 2019 - versagte die Beigeladene zu 2) unter Bezug auf § 14 LuftVG (nach Beteiligung der Deutschen Flugsicherung GmbH - DFS -, die ihrerseits das Luftfahrtamt der Bundeswehr beteiligt habe, vgl. Bl. 81 der Beiakte), wegen der Lage innerhalb des Sicherheitskorridors einer Hubschraubertiefflugstrecke ihre Zustimmung zu den WEA 2, 3 und 5, stimmte hingegen den WEA 1 und 4 unter Auflagen zu. Am Ende des Schreibens wurde allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Entscheidung des Bundesamtes abzuwarten sei, da andere militärische Belange betroffen sein könnten.
Dieses Bundesamt versagte dann mit Schreiben vom 17. September 2019 seine Zustimmung zum Bau von allen fünf WEA. Zur Begründung wurde zunächst auf die Lage innerhalb des sog. Flugbeschränkungsgebiets ED-R32 B um den Übungsplatz Munster-Nord verwiesen; dieses Gebiet werde für den militärischen Flugübungsbetrieb in geringen Höhen mit Hubschraubern, Drohnen ("luftgestützte unbemannte Aufklärung") und teilweise Strahlenflugzeugen genutzt und müsse deshalb von höheren Hindernissen freigehalten werden. Zudem lägen die WEA 2, 3 und 5 innerhalb des Korridors der Hubschraubertiefflugstrecke Seedorf, die Mastfüsse der WEA 1 und 4 befänden sich jeweils minimal außerhalb, jedoch ragten die Rotoren in den Korridor. Die WEA stellten wegen dieser Lage eine konkrete Gefahr dar. Schließlich befänden sich die WEA in einer Entfernung von ca. 14,4 bis 15,5 km zum Radar des (Militär-)Flugplatzes Faßberg. Sie "generierten eine Störzone" und stellten deshalb ein nicht hinnehmbares Risiko dar. Eine Rechtsgrundlage für die Stellungnahme wurde nicht genannt, allerdings am Ende des Schreibens, auf das wegen der Einzelheiten verwiesen wird, auf die gesonderte Beurteilung durch die Beigeladene zu 2) nach § 14 LuftVG allgemein hingewiesen.
Der Beklagte lehnte nach Anhörung der Beigeladenen zu 1) mit Bescheid vom 10. Dezember 2019 die Erteilung des Vorbescheides insgesamt ab. Zur Begründung wurde der Inhalt der beiden Schreiben der "zivilen und militärischen Luftfahrtbehörden" wiedergegeben; ohne ihre Zustimmung könne der Vorbescheid nicht erteilt werden. Als Rechtsgrundlage wurde in dem Schreiben § 14 LuftVG angeführt, nicht aber § 18a LuftVG. Nach späteren internen Ausführungen erfolgte die Ablehnung inhaltlich wegen der Stellungnahme des Bundesamtes (vgl. Bl. 80, 129 der Beiakte).
Die Beigeladene zu 1) legte am 7. Januar 2020 Widerspruch ein. Für die WEA 1 und 4 liege die nach § 14 LuftVG erforderliche und für den Beklagten bindende Zustimmung der (ausschließlich zuständigen) Beigeladenen zu 2) vor. Der Beklagte befragte dazu die Beigeladene zu 2). Diese teilte am 2. Juli 2020 mit, dass das - nicht mit dem o. a. Bundesamt identische - "Luftfahrtamt der Bundeswehr seine Stellungnahme gegenüber der DFS geändert habe", sie deshalb ihre (Teil-)Zustimmung nach § 14 LuftVG vom 30. August 2019 zurücknehme und diese insgesamt versage. Zur Begründung wurde auf die Lage aller WEA in dem Flugbeschränkungsgebiet ED-R 32 B sowie innerhalb des Sicherheitskorridors der Tiefflugstrecke verwiesen. Die dazu angehörte Beigeladene zu 1) vertrat hingegen die Ansicht, dass eine nach § 14 LuftVG erteilte Zustimmung nicht aufgehoben werden könne. Die Klägerin wurde vom Beklagten im Widerspruchsverfahren nicht beteiligt.
Unter dem 3. Februar 2021 änderte der Beklagte im Wege der Teilabhilfe seinen Bescheid vom 10. Dezember 2019 und "bestätigte" unter Berufung auf die unter dem 30. August 2019 erfolgte, für ihn bindende, nicht änderbare Teilzustimmung der Beigeladenen zu 2) nunmehr die luftfahrtrechtliche Genehmigungsfähigkeit der WEA 1 und 4. "Die Einwände der militärischen Luftfahrtbehörde" seien "auf der Ebene der zivilen Luftfahrtbehörde zu beachten, nicht aber auf der Ebene der Genehmigungsbehörde". Diesen Bescheid gab der Beklagte u. a. auch dem Bundesamt bekannt.
Entsprechend der dem Bescheid beigefügten, auch auf Nachfrage und Hinweise zunächst nicht geänderten Rechtsbehelfsbelehrung legte das Bundesamt gegen den Teilabhilfebescheid vorsorglich Widerspruch ein. Zur Begründung machte es geltend, dass das Luftfahrtamt der Bundeswehr irrtümlich gegenüber der DFS seine Zustimmung zu den WEA 1 und 4 erteilt habe, diese Stellungnahme aber nach Rücksprache mit der "Truppenübungsplatzkommandantur Munster" geändert habe; erst dadurch sei das Luftfahrtamt nämlich auf die Lage im ED-R 32 hingewiesen worden. Daraufhin habe die Beigeladene zu 2) ihre Teilzustimmung zu Recht widerrufen; dies sei "in entsprechender Anwendung des § 183 BGB" möglich gewesen. Hilfsweise sei der Vorbescheid zu versagen gewesen, weil die genannten militärischen Gründe dem Vorhaben der Beigeladenen zu 1) jedenfalls auch als unbenannte öffentliche Belange nach § 35 Abs. 1, 3 BauGB entgegenstünden. Der Teilabhilfebescheid sei deshalb seinerseits aufzuheben.
"Trotz gewisser inhaltlicher Zweifel" (Bl. 210 der Beiakte) wies der Beklagte den Widerspruch der Klägerin mit Bescheid vom 21. Juli 2021 als "zulässig, aber unbegründet" zurück.
Am 26. August 2021 hat die Klägerin den Verwaltungsrechtsweg beschritten. Zur Klagebegründung hat sie zunächst ihr Vorbringen aus dem Widerspruchsverfahren wiederholt und vertieft. Im Anschluss an einen gerichtlichen Hinweis hat sie sich mit Schriftsatz vom 22. September 2022, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen wird, ergänzend darauf berufen, dass der Vorbescheid auch wegen ihrer (stets) fehlenden, aber (kumulativ zu der nach § 14 LuftVG) erforderlichen Entscheidung nach § 18a Abs. 1 LuftVG, also wegen Beeinträchtigung flugsicherungstechnischer Belange, nicht hätte erteilt werden dürfen. Soweit ggf. der Anlagenschutzbereich ihrer Radaranlage in Faßberg nicht hinreichend veröffentlich worden sei, stehe dieser Gesichtspunkt jedenfalls der Wirksamkeit ihrer hier streitigen ablehnenden Entscheidung gegenüber der Beigeladenen zu 1) nicht entgegen; die maßgebliche Störung ihrer Anlage sei jedenfalls zu bejahen.
Nach gerichtlichem Hinweis hat der Beklagte seinen Widerspruchsbescheid mit Bescheid vom 14. September 2022 aufgehoben und haben die Hauptbeteiligten insoweit den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt.
Die Klägerin beantragt,
den Teilabhilfebescheid des Beklagten vom 3. Februar 2021 aufzuheben.
Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Über die Begründung seines Widerspruchsbescheides hinaus hat er geltend gemacht, dass das Schreiben des Bundesamtes vom 17. September 2019 von ihm nicht habe beachtet werden dürfen, weil für die Zustimmung nach § 14 LuftVG allein die Beigeladene zu 2) zuständig sei und diese am 30. August 2019 ihre nicht widerrufbare (Teil-)Zustimmung erteilt habe. Es sei unverständlich, dass dem Luftfahrtamt der Bundeswehr bei Abgabe seiner ursprünglich zustimmenden Stellungnahme die Lage in dem Flugbeschränkungsgebiet ED-R 32 B entgangen sein solle. Zur Frage nach der Bindung an die inhaltlich auf § 18a LuftVG bezogene, ablehnende Entscheidung der Klägerin hat sich der Beklagte nicht geäußert.
Die Beigeladene zu 1) beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie vertritt ebenfalls die Ansicht, eine - wie hier - einmal erteilte Zustimmung der zuständigen Luftverkehrsbehörde nach § 14 LuftVG sei nicht widerrufbar und damit für die Immissionsschutzbehörde bindend; jedenfalls könne die Zustimmung nach Erteilung der "Genehmigung" nicht mehr widerrufen werden. Eine solche Zustimmung habe für die WEA 1 und 4 vorgelegen; ein Widerruf sei - zumal erst nach der Entscheidung über den Vorbescheid - ausgeschlossen. Im Übrigen ergebe sich aus der Lage der WEA 1 und 4 in einem Flugbeschränkungsgebiet sowie ihrer Rotoren innerhalb der Hubschraubertiefflugstrecke noch nicht die für die Versagung der Zustimmung nach § 14 LuftVG erforderliche konkrete Gefahr. § 14 LuftVG sei insoweit abschließend und lasse keinen Rückgriff auf § 35 Abs. 3 BauGB unter dem gleichen Aspekt zu.
Soweit das Bundesamt die Ablehnung auch auf § 18a LuftVG gestützt habe, sei diese Ablehnung nicht hinreichend konkret und unzureichend begründet. Zudem fehle die erforderliche Veröffentlichung des Anlagenschutzbereichs bezogen auf die Radaranlage in Faßberg. Außerdem wäre eine Zustimmung unter Nebenbestimmungen in Betracht gekommen.
Die Beigeladene zu 2) stellt keinen Antrag, tritt in der Sache aber der Ansicht der Klägerin bei.
Eine einmal nach § 14 LuftVG erteilte Zustimmung könne in entsprechender Anwendung von § 183 BGB "widerrufen" werden, wenn sie - wie hier - rechtswidrig gewesen sei.
Unabhängig hiervon sei der Vorbescheid schon deshalb zu versagen gewesen, weil neben ihrer Zustimmung nach § 14 LuftVG kumulativ noch die positive Entscheidung des Bundesamtes nach §§ 18a, 30 Abs. 2 LuftVG hinsichtlich einer etwaigen Beeinträchtigung militärischer Flugsicherungsanlagen erforderlich gewesen sei; diese sei hier aber gerade nicht erfolgt, sondern - bereits anfänglich - versagt worden.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den übrigen Inhalt der Gerichtsakte und der Beiakten verwiesen, die ihrem wesentlichen Inhalt nach Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.
Entscheidungsgründe
Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit (bezogen auf den Widerspruchsbescheid) übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist das Verfahren in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 3 VwGO einzustellen.
Die im Übrigen aufrechterhaltene Klage gegen den Teilabhilfebescheid ist zulässig (1.) und begründet (2.).
1. a) Die Klägerin ist klagebefugt (§ 42 Abs. 2 VwGO).
aa) Sie kann schon dadurch, dass es bei der umstrittenen Wirksamkeit des "Widerrufs" bzw. der Aufhebung der Zustimmung der Beigeladenen zu 2) nach § 14 LuftVG aus Gründen der Beeinträchtigung der militärischen Flugsicherheit für den Vorbescheid an dieser notwendigen Zustimmung mangelt, in ihren "Rechten" verletzt sein (vgl. Senatsurt. v. 13.11.2019 - 12 LB 123/19 -, juris, Leitsatz).
bb) Zudem kommt eine solche Rechtsverletzung auch wegen der Missachtung einer daneben kumulativ erforderlichen positiven, hier aber versagten (vgl. dazu nachfolgend unter 2.b) aa) Entscheidung, d. h. der Zustimmung der Klägerin selbst, nach §§ 18a Abs. 1, 30 Abs. 2 Satz 4 bis 6 LuftVG im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchtigung ihrer Flugsicherungsanlagen in Betracht.
cc) Schließlich ist eine Rechtsverletzung auch insoweit möglich, als der für den Erlass des Vorbescheides erforderlichen (s. nachfolgend) vorläufigen positiven Gesamtbeurteilung ggf. als öffentlicher Belang i. S. d. § 35 Abs. 1, 3 Satz 1 Nr. 8 Alt. 2 BauGB sonstige militärische Belange entgegenstehen können, wie etwa eine Beeinträchtigung der - bislang nicht unter § 18a LuftVG fallenden - Luftverteidigungsradaranlage Visselhövede.
b) Die Klage ist fristgerecht erhoben worden.
Nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VwGO "bedarf es" keines (weiteren) Widerspruchsverfahrens, wenn der Abhilfebescheid erstmals eine Beschwer enthält. Dies war hier für die Klägerin bezogen auf den Teilabhilfebescheid vom 3. Februar 2021 der Fall, da darin erstmals die luftverkehrsrechtliche Zulässigkeit der beiden WEA 1 und 4 bescheinigt worden war und sie, d. h. die Klägerin, im Falle der Bestandskraft dieses Bescheides daher die von ihr geltend gemachten Beeinträchtigungen ihres militärischen Flugbetriebs ggf. hätte hinnehmen müssen, also insoweit "beschwert" ist. Das "bedarf es nicht" ist dabei so zu verstehen, dass ein solches Widerspruchsverfahren zugleich unstatthaft ist (vgl. auch zum Folgenden: BVerwG, Urt. v. 12.8.2014 - 1 C 2/14 -, juris, Rn. 13 ff., m. w. N.). Der Widerspruchsbehörde steht jedenfalls in den Fällen, in denen der in Rede stehende Bescheid für einen Beteiligten begünstigend und für andere belastend ist - wie hier -, auch nicht die Kompetenz zu, gleichwohl "freiwillig" ein (weiteres) Widerspruchsverfahren durchzuführen. Damit musste die Klägerin unmittelbar gegen den Abhilfebescheid vom 3. Februar 2021 Anfechtungsklage erheben.
Ihre im August 2021 erhobene Klage ist noch fristgerecht.
Nach dem Wortlaut des § 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO beträgt die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs im Falle einer "unrichtigen" Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich ein Jahr. Hier war die Belehrung jedenfalls insoweit unrichtig, als danach gegen den Teilabhilfebescheid (nur) der Widerspruch statthaft sein sollte. Diese Belehrung ist auch auf ausdrückliche Nachfrage der Klägerin und trotz des Hinweises durch die Beigeladene zu 1) auf die Fehlerhaftigkeit der Belehrung vom Beklagten zunächst nicht korrigiert worden. Innerhalb der damit dem Wortlaut des § 58 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 VwGO nach ab Bekanntgabe des Teilabhilfebescheides an sie, die Klägerin, im Februar 2021 laufenden Jahresfrist ist die Klage erhoben worden.
Versteht man § 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO dahin, dass der Fall einer Belehrung über einen falschen Rechtsbehelf kein Anwendungsfall ihrer "Unrichtigkeit" sei, sondern der Belehrung darüber gleichgestellt werden müsse, dass kein Rechtsbehelf gegeben sei, (vgl. BVerwG, Urt. v. 25.6.1985 - 8 C 116/84 -, juris, Rn. 8 f.), so lief entsprechend § 58 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 Alt. 2 VwGO vorliegend gar keine Frist zur Klageerhebung.
2. Die Klage ist auch begründet, weil der Teilabhilfebescheid rechtswidrig ist und die Klägerin in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 1 VwGO.
a) Dahinstehen kann, ob dieser Bescheid schon formell rechtswidrig ist.
aa) Dies gilt zunächst wegen eines etwaigen Verstoßes gegen die Anhörungspflicht aus § 71 VwGO.
Denn danach soll, wenn mit der Änderung eines Verwaltungsaktes im Widerspruchsverfahren erstmalig eine Beschwer verbunden ist, der Betroffene vor Erlass (auch) des Abhilfebescheides gehört werden. Dies ist hier bezogen auf die Klägerin zu Unrecht zunächst unterblieben.
Der ablehnende Ausgangsbescheid ist im Abhilfeverfahren hinsichtlich der luftverkehrsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit der WEA 1 und 4 geändert worden. Damit war eine "Beschwer" für die Klägerin insbesondere als Trägerin und Verantwortliche für die Sicherheit des militärischen Flugverkehrs nach Art. 87a Abs. 1 GG verbunden. Dies gilt ersichtlich für die nach § 30 Abs. 2 Satz 4 bis 6 LuftVG unmittelbar und abschließend von Dienststellen der Bundeswehr zu beurteilende (und von dieser zuvor verneinte) Vereinbarkeit des Betriebs der WEA mit den eigenen Flugsicherungsanlagen der Klägerin, aber auch bezogen auf die Sicherheit des militärischen Flugbetriebs, etwa im Hubschraubertieffluggebiet, im Übrigen; obwohl die Zuständigkeit für die Erteilung der Zustimmung insoweit nach § 14 LuftVG bei der Beigeladenen zu 2) liegt, sind diesbezüglich bei einem militärischen Flugbetrieb (nur) materielle Rechte der Klägerin betroffen. Ein Ausnahmefall, in dem von der Anhörung abgesehen werden konnte, lag nicht vor. Weder gab es dafür eine zeitliche noch eine inhaltliche Notwendigkeit; im Gegenteil hätte eine rechtzeitige Beteiligung gerade auch der Klägerin unmittelbar dem Beklagten ggf. bereits im Abhilfeverfahren die notwendige Rechtskenntnis über die unterschiedlichen betroffenen rechtlichen Interessen der Klägerin verschaffen können. Da der Beklagte die Klägerin im Ausgangsverfahren beteiligt und ihre Argumente im ablehnenden Ausgangsbescheid übernommen hatte sowie ihr nachfolgend auch den Teilabhilfebescheid bekanntgegeben hat, spricht Überwiegendes dafür, dass ihre Beteiligung im Abhilfeverfahren an sich auch aus Sicht des Beklagten erforderlich war, er dies aber schlicht übersehen hat.
Ob dieser Verstoß gegen § 71 VwGO durch die Anhörung der Klägerin im Rahmen des unstatthaften Widerspruchsverfahrens und nach erfolgter Aufhebung des Widerspruchsbescheides geheilt worden ist, ist zweifelhaft, bleibt hier aber offen.
bb) Nach § 9 Abs. 1 BImSchG soll auf Antrag über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen ... entschieden werden, sofern die Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden können ... Der Antragsteller kann danach einzelne für die Genehmigung relevante Fragen, die im Vorgriff auf sie rechtlich und tatsächlich geklärt werden können, zum Gegenstand des Vorbescheides machen. Das bedeutet indes nicht, dass die nicht zur abschließenden Prüfung gestellten Fragen im Verfahren auf Erteilung eines Vorbescheides gänzlich unberücksichtigt bleiben können. Vielmehr ist Gegenstand des Vorbescheides zusätzlich die Prüfung der Auswirkungen der gesamten "geplanten Anlage". Damit ist nach der Senatsrechtsprechung (vgl. schon Urt. v. 21.4.2010 - 12 LB 44/09 -, juris, Rn. 57) nichts Anderes gemeint als die in § 8 Satz 1 Nr. 3 BImSchG im Fall der Teilgenehmigung ausdrücklich angesprochene vorläufige Gesamtbeurteilung, die ergeben muss, dass der Errichtung und dem Betrieb der gesamten Anlage keine von vornherein unüberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen. Um dies beurteilen zu können, hat der jeweilige Antragsteller seinem Vorbescheidsantrag hinreichend aussagekräftige Unterlagen beizufügen (vgl. Senatsbeschl. v. 14.2.2022 - 12 MS 172/21 - juris, Rn. 52, m. w. N). Entgegen des Vorbringens des Beklagten steht es nicht zur Disposition des Antragstellers bzw. der Genehmigungsbehörde, auf die Prüfung dieses gesetzlichen Tatbestandsmerkmals zu verzichten.
Vorliegend mangelt es jedoch im sog. Teilabhilfebescheid des Beklagten vom 3. Februar 2021 an einer entsprechenden Feststellung und dürften dafür zudem, wie der Beklagte selbst einräumt, auch die Antragsunterlagen unzureichend gewesen sein.
Ob in dieser unterbliebenen Feststellung des Beklagten ein unmittelbar oder mittelbar - wegen der auch dadurch bedingten Unklarheit über den Regelungsgehalt des erteilten Vorbescheids - von der Klägerin rügefähiger Rechtsfehler liegt, lässt der Senat dahinstehen.
cc) Gleiches gilt für die Frage, ob für die Feststellung der vorläufigen positiven Gesamtbeurteilung des Vorhabens der Klägerin hier nicht zumindest eine standortbezogene Umweltverträglichkeitsvorprüfung erforderlich gewesen ist, auf deren Fehlen sich die Klägerin nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) UmwRG grundsätzlich erfolgreich berufen kann.
b) Der Teilabhilfebescheid ist jedenfalls materiell rechtswidrig und verletzt insoweit die o. a. Rechte der Klägerin.
aa) Dies gilt zunächst im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens der Beigeladenen zu 1) bezüglich der von der Klägerin selbst betriebenen Flugsicherungsanlage in Faßberg.
Anders als hinsichtlich der notwendigen Zustimmung nach § 14 LuftVG, die auch für den militärischen Flugbetrieb in Niedersachsen in die Zuständigkeit der Beigeladenen zu 2) fällt (vgl. Senatsurt. v. 13.11.2019 - 12 LB 123/19 - juris, Rn. 56 a. E.), liegt jedenfalls insoweit, d. h. hinsichtlich der Beurteilung der Beeinträchtigung von militärischen Flugsicherungsanlagen, nach §§ 18a, 30 Abs. 2 Satz 4 LuftVG die Zuständigkeit bei "Dienststellen der Bundeswehr" (vgl. etwa VG Aachen, Urt. v. 24.7.2013 - 6 K 248/09 -, juris, Rn. 65 ff.; Weiss, NVwZ 2013, 14 f. [zu II. 1.c) bb)]).
Die "Entscheidung" der Klägerin nach §§ 18a, 30 Abs. 2 Satz 5 und 6 LuftVG ist vorliegend kumulativ zu der Zustimmung der Beigeladenen zu 2) nach § 14 LuftVG erforderlich und für den Beklagten als Genehmigungsbehörde bindend (vgl. Senatsbeschl. v. 14.5.2021 - 12 LA 175/18 - juris, Rn. 29).
Dieses Teilelement war auch von der - in seiner Bestimmtheit ansonsten zweifelhaften - Vorbescheidsanfrage der Beigeladenen zu 1) vom Juli 2019 umfasst. Denn dem Antrag beigefügt und bei seinem Verständnis zu berücksichtigen war das vorhergehende Schreiben der Klägerin vom 15. April 2019, in der bereits gesondert auf den betroffenen "Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung dieses Flugplatzes (§ 18a LuftVG)" verwiesen worden war. Wenn sich der von der Beigeladenen zu 1) unter Vorlage dieses Schreibens beantragte Vorbescheid allgemein auf etwaige entgegenstehende "luftverkehrsrechtliche Belange" beziehen sollte, so war damit von der Fragestellung auch die Klärung der Vereinbarkeit ihres Vorhabens mit § 18a LuftVG eingeschlossen; andernfalls stellte dieser Aspekt zumindest einen sonstigen Grund für die Versagung des Vorbescheids im Rahmen der erforderlichen, dann insoweit aber zu verneinenden vorläufigen positiven Gesamtbeurteilung dar.
Eine gesonderte Veröffentlichung von Anlagenschutzbereichen um entsprechende militärische (stationäre) Flugsicherungsanlagen der Klägerin ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Verweigerung der Zustimmung bzw. Entscheidung nach § 18a Abs. 1 LuftVG. Denn diese Bekanntgabe dient der Information der Öffentlichkeit. Ob und in welcher Form genau die Klägerin nach § 30 Abs. 2 Satz 4 ff. LuftVG zu einer solchen Veröffentlichung überhaupt verpflichtet ist, kann deshalb offenbleiben; so könnten dagegen etwa Gründe der militärischen Sicherheit sprechen. Im Übrigen lässt sich aus den von der Klägerin auf gerichtliche Nachfrage bezeichneten veröffentlichten Angaben im militärischen Luftfahrthandbuch (www.milais.org) immerhin entnehmen, dass es - u. a. in Faßberg - entsprechende militärische Radaranlagen gibt, auch wenn der Umfang des damit verbundenen Anlagenschutzbereichs dort nicht (erkennbar) ausdrücklich genannt wird. Dass sich die in Rede stehenden WEA im (Radar-)Anlagenschutzbereich des Militärflugplatzes Faßberg befinden, war den Beteiligten hier außerdem schon vor der Einleitung des Vorbescheidsverfahrens anderweitig, nämlich durch das Schreiben der Klägerin vom April 2019, bekannt, ergab sich ferner aus den Unterlagen (Gebietsblatt) zu dem entsprechenden Vorranggebiet im RROP 2019 des Beklagten und hatte gerade auch den Vorbescheidsantrag mit veranlasst.
Die demnach bei der beabsichtigten Verwirklichung des klägerischen Vorhabens im Anlagenschutzbereich der militärischen Flugsicherungsanlage in Faßberg notwendige Zustimmung der Klägerin nach § 18a LuftVG liegt aber nicht vor, sondern ist im Gegenteil mit Schreiben vom 17. September 2019 versagt worden. Danach befinden sich die geplanten WEA in einer Entfernung von ca. 14,4 bis 15,5 km zum Radar des (Militär-)Flugplatzes Faßberg und in dessen Anlagenschutzbereich. Sie "generierten eine Störzone" und stellten deshalb ein nicht hinnehmbares Risiko dar. Auch wenn in dieser Stellungnahme nicht ausdrücklich auf § 18a LuftVG als Rechtsgrundlage Bezug genommen wurde und sie zugleich Elemente enthielt, die eigentlich Bestandteil der gesonderten Stellungnahme der Beigeladenen zu 2) zu § 14 LuftVG sind, so war sie doch insoweit eigenständig und für den Beklagten bindend.
Auf die Fragen, ob diese Entscheidung der "Bundeswehr" materiell richtig war und hinreichend begründet wurde, kommt es in dem Anfechtungsverfahren der Trägerin dieser Anlage hingegen nicht an; es besteht insoweit keine gerichtliche Befugnis, ihre ablehnende Entscheidung gerichtlich zu ersetzen bzw. sie dazu zu verpflichten (vgl. bereits Senatsurt. v. 13.11.2019 - 12 LB 123/19 - juris, Rn. 64 unter Bezug u. a. auf den gerade zu § 18a LuftVG ergangenen Senatsbeschl. v. 22.1.2015 - 12 ME 39/14 -, juris, Rn. 27 sowie nochmals Senatsbeschl. v. 14.5.2021, a. a. O., juris Leitsatz sowie Rn. 29). Anders als nach § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG gibt es insoweit ferner keine Rechtsnorm, wonach bei einer unterlassenen Entscheidung diese als - mit positivem Ergebnis - erteilt gilt. Schließlich war auch der Beklagte als Immissionsschutzbehörde nicht berechtigt, die inhaltliche Richtigkeit der von der Klägerin geltend gemachten Beeinträchtigung ihrer Radaranlage zu überprüfen, noch wäre er dazu mutmaßlich fachlich in der Lage gewesen.
Der Beklagte hat sich dementsprechend ursprünglich in seinem ablehnenden Ausgangsbescheid vom 10. Dezember 2019 (auf S. 2 unten/ 3 oben) selbst auch ausdrücklich (und damit zunächst richtig) auf diesen Ablehnungsgrund berufen, auch wenn ihm dabei offenbar die eigenständige Bedeutung dieses Teil der ablehnenden Stellungnahme der Klägerin nach dem - im Bescheid ungenannten - § 18a LuftVG nicht vor Augen stand.
Dass der Beklagte dann im Abhilfeverfahren unter dem Einfluss des anwaltlichen Vorbringens der Beigeladenen zu 1) seinen ablehnenden Ausgangsbescheid in Verkennung der eigenständigen Bedeutung der Entscheidung der Klägerin hinsichtlich des § 18a LuftVG teilweise aufhob, war folglich rechtswidrig und verletzte die Klägerin schon in ihrem einfach-rechtlichen Status aus §§ 18a, 30 Abs. 2 Satz 4 bis 6 LuftVG.
Dem Gericht ist es schließlich nicht nach § 6 UmwRG versagt, das Urteil auf diesen Gesichtspunkt zu stützen, auch wenn sich die Klägerin darauf innerhalb der sich aus Satz 1 dieser Norm ergebenden Klagebegründungsfrist selbst nicht unmittelbar berufen hat. Denn der wesentliche Sachverhalt - die fehlende Zustimmung der Klägerin nach § 18a LuftVG - war jedenfalls mit wenig Aufwand i. S. d. § 6 Satz 3 UmwRG, § 87b Abs. 3 Satz 3 VwGO gerichtlich zu ermitteln.
bb) Im Übrigen und selbständig tragend ist die Erteilung des Vorbescheids auch hinsichtlich der eingeschlossenen Bejahung der Vereinbarkeit mit den flugbetrieblichen Belangen der Klägerin rechtswidrig und verletzt diese in ihren Rechten.
Über diese Belange befindet im Verhältnis zum Beklagten nach § 14 LuftVG zwar unmittelbar die Beigeladene zu 2). Mangels näherer Kenntnisse der Notwendigkeiten gerade des militärischen Flugbetriebs und eines insoweit in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannten verteidigungspolitischen Beurteilungsspielraums der Klägerin spricht jedoch mehr dafür, dass die inhaltliche Entscheidungskompetenz insoweit bei der Klägerin liegt; wie bereits im Senatsurteil vom 13. November 2019 (- 12 LB 123/19 - juris, Rn. 58) ausgeführt, wird in der Praxis (in Niedersachsen) entsprechend verfahren. Die Beteiligung der Klägerin wird dabei durch eine mit der DFS geschlossene Verwaltungsvereinbarung sichergestellt.
Hier hat die Beigeladene zu 2) zuletzt mit Schreiben vom 2. Juli 2020 ihre notwendige und auch insoweit in diesem Verfahren nicht gerichtlich ersetzbare Zustimmung nach § 14 LuftVG versagt. Danach hat das - nicht mit dem o. a. Bundesamt identische - "Luftfahrtamt der Bundeswehr seine vorhergehende Stellungnahme gegenüber der DFS geändert"; sie, die Beigeladene zu 2), nehme deshalb ihre (Teil-)Zustimmung nach § 14 LuftVG vom 30. August 2019 zurück und versage diese insgesamt. Zur Begründung wurde auf die Lage aller WEA in dem o. a. Flugbeschränkungsgebiet sowie innerhalb des Sicherheitskorridors der Tiefflugstrecke verwiesen. Jedenfalls mit dem Verweis auf die Lage in dem nach § 26 Abs. 2 LuftVG i. V. m. § 17 Abs. 1 Satz 2 LuftVO vom Bundesverkehrsministerium festgelegten Flugbeschränkungsgebiets ED-R 32 B um den Übungsplatz Munster-Nord (vgl. zu dessen genauer Lage und Bekanntgabe Bl. 71 ff. der Gerichtsakte) ist diese ablehnende Haltung rechtmäßig. Denn dieses Gebiet wird fortlaufend bestimmungsgemäß auch (vgl. Schriftsatz der Klägerin v. 29.9.2022, Bl. 98 ff. GA) für den militärischen Flugübungsbetrieb in geringen Höhen mit Hubschraubern, Drohnen ("unbemannte luftgestützte Aufklärung") und teilweise Strahlenflugzeugen genutzt und muss deshalb nachvollziehbar von höheren, sich bewegenden Hindernissen, wie sie WEA darstellen, freigehalten werden (vgl. Senatsbeschl. v. 28.3.2017 - 12 LA 25/16 -, juris, Rn. 18 ff.).
Der Berücksichtigungsfähigkeit dieser versagenden Stellungnahme der Beigeladenen zu 2) vom 2. Juli 2020 steht nicht entgegen, dass sie den hier noch streitigen WEA 1 und 4 bei objektiv wohl gleicher Lage noch unter dem 30. August 2019 zugestimmt hatte. Der insbesondere von der Beigeladenen zu 1) geltend gemachten und vom Beklagten tragend übernommenen Annahme, die nach § 14 LuftVG zuständige Behörde könne ihre Zustimmung gegenüber der Genehmigungsbehörde nicht nachträglich ändern (so Weiss, NVwZ 2013, 14, 16 f.; unklar: Wysk, in: Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 12, Stand: Januar 2021, Rn. 63, 67 und 83, a. A. wohl Bay. VGH, Beschl. v. 6.10.2014 - 22 ZB 14.1079 - juris, Rn. 13 f.), kann nicht gefolgt werden.
Dies gilt zunächst für den zweigeteilten Begründungsansatz, wonach aus der in § 14 Abs. 1 Halbsatz 2 LuftVG enthaltenden Verweisung auf § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG - danach gilt die in Rede stehende Zustimmung der Luftfahrtbehörde als erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der für die Erteilung einer Baugenehmigung zuständigen Behörde verweigert wird - folge, dass diese Zustimmung nur bei einer - hier fehlenden - ausdrücklichen gesetzlichen Regelung wieder geändert werden könne. Weder § 12 noch § 14 (oder andere entsprechende Vorschriften des) Luftverkehrsgesetz(es) befassen sich nämlich ausdrücklich mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine nach den §§ 12 ff. LuftVG erforderliche Zustimmung änderbar ist. Diese Lücke ist einheitlich nach allgemeinen Grundsätzen zu schließen und kann nicht dadurch ignoriert bzw. das Ergebnis der Lückenfüllung vorweggenommen werden, dass in § 12 Abs. 2 LuftVG inzident eine gesetzliche Regelung zur fehlenden Änderbarkeit hineingelesen wird, die nur durch eine gegenteilige - aber natürlich fehlende - ausdrückliche gesetzliche Regelung modifizierbar sei.
Ausgehend hiervon spricht zwar für eine fehlende Änderbarkeit der Zustimmung, dass die Genehmigungsbehörde für das weitere Verwaltungsverfahren möglichst schnell Klarheit über die luftverkehrsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens gewinnen soll und sie dieses Verwaltungsverfahren ggf. umsonst fortführt, wenn eine vorherige Zustimmung nachträglich aufgehoben wird; diese Argumentation verliert aber schon dadurch an Wert, dass für die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung - wie hier - mehrere behördeninterne Entscheidungen bzw. Zustimmungen nebeneinander erforderlich sein können und für die gesonderte Entscheidung nach § 18a LuftVG keine entsprechende Entscheidungsfrist gesetzlich vorgesehen ist, d. h. die Genehmigungsbehörde muss dann ohnehin bis zum Eingang der letzten positiven Mitwirkungshandlung warten. Zudem hat sich die Schließung von Lücken insoweit an den allgemeinen grundsätzlichen, teilweise bereits verfassungsrechtlich fundierten Vorgaben für Verwaltungsverfahren zu orientieren, wie dies etwa vor der Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts im VwVfG für die Regeln über Aufhebbarkeit von Verwaltungsakten der Fall war (vgl. insoweit: Suerbaum, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG; 2. Aufl., § 48, Rn. 7 f., m. w. N.). Ausgehend von dem elementaren Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung sind danach ihre rechtswidrige Handlungen, wie die hier in Rede stehende Zustimmung, - soweit überhaupt wirksam - jedenfalls dann grundsätzlich (bei Rechtswidrigkeit) rücknehmbar, soweit dem nicht ein schutzwürdiges Vertrauen des Begünstigten entgegensteht (vgl. zur analogen Anwendung dieses Grundgedankens von § 48 VwVfG auf verbindliche öffentlich-rechtliche behördliche Entscheidungen ohne VA-Qualität auch Ramsauer, in: Kopp/Ramsauer, VwVfG, 23. Aufl., § 48, Rn. 23, m. w. N.; Kluth, NVwZ 1990, 608, 612, sowie ausdrücklich "für die verwaltungsinterne Zustimmung einer Behörde gegenüber einer anderen Behörde zur Erteilung einer Genehmigung" Schoch, in: ders./Schneider, Verwaltungsverfahrensrecht, VwVfG, Stand: August 2022, § 48, Rn. 76 unter Bezug auf SächsOVG, Urt. v. 18.1.2006 - 1 B 444/05 -, SächsVBl 2006, 140, 142, hier zit. nach juris, Rn, 37). Anlass, von diesem Grundsatz hier abzuweichen, besteht nicht. Dem Luftverkehrsgesetz selbst lässt sich, wie dargelegt, dazu keine eindeutige Entscheidung entnehmen. Mit der Möglichkeit, eine einmal erteilte Zustimmung unter den bezeichneten Voraussetzungen zu korrigieren, kann zwar eine unbeabsichtigte Verfahrensverzögerung verbunden sein. Ungeachtet dessen spricht entscheidend für die Annahme einer solchen Möglichkeit, dass andernfalls die Sicherheit des Luftverkehrs erheblich beeinträchtigt sein kann, wenn zu Unrecht an der Zustimmung zur Verwirklichung eines Luftfahrthindernisses festgehalten würde. Bei der Sicherheit des Luftverkehrs handelt es sich um ein besonders hochrangiges Rechtsgut, da ein an falscher Stelle platziertes Luftfahrthindernis im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben kann. Wenn die beteiligte Luftfahrtbehörde dies zunächst übersehen hat, so spricht wenig bis nichts für die Annahme, ihr sei vom Gesetzgeber bewusst die Möglichkeit der Selbstkorrektur genommen. Dies gilt zusätzlich vor dem Hintergrund, dass auch die Genehmigungsbehörde weder zu einer eigenen Überprüfung noch zur Korrektur berufen, sondern an die Entscheidung der Luftfahrtbehörde gebunden ist, die erstgenannte also "sehenden Auges" ein solches Hindernis genehmigen müsste (vgl. Bay. VGH, a. a. O). Es nunmehr Dritten im Wege der Anfechtungsklage zu überlassen, eine solche inhaltlich rechtswidrige Genehmigung gerichtlich aufheben zu lassen (vgl. Weiss, a. a. O.), kann schon deshalb nicht überzeugen, weil unklar ist, ob und in welchen Fällen Dritten überhaupt eine solche Anfechtungsmöglichkeit zusteht (vgl. Senatsurt. v. 13.11.2019 - 12 LB 123/19 - juris, Rn. 71 unter Bezug auf das vorhergehende Urt. v. 18.7.2007 - 12 LC 56/07 -, juris, Rn. 43), soweit vorrangig Interessen der Allgemeinheit betroffen sind. Ebenso wenig ist sichergestellt, dass sich stattdessen der Luftverkehr anpasst und das neue Hindernis stets umgeht bzw. umgehen kann oder nunmehr die Luftverkehrsbehörde unmittelbar gegen das Hindernis einschreiten darf (vgl. ablehnend: VG Minden, Beschl. v. 23.1.2002 - 3 L 47/02 - Rn. 8). Zudem ist unmittelbarer Adressat der Zustimmungserklärung nach § 12 Abs. 2 LuftVG ohnehin nicht der jeweilige Vorhabenträger, sondern die Genehmigungsbehörde, der dann die weitere Verfahrensherrschaft obliegt. Die Rücknehmbarkeit stattdessen in entsprechender Anwendung von § 183 BGB von dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der (fehlerhaften) Zustimmung an die Genehmigungsbehörde bzw. den Vorhabenträger oder der Genehmigungserteilung (so VG Regensburg, Urt. v. 13.1.2014 - RO 7 K 12.631 - juris, Rn. 50) abhängig zu machen, hat daher keine Grundlage, würde insoweit von Zufälligkeiten abhängen und zudem die Aufhebbarkeit zu Unrecht von der Rechtmäßigkeit der vorhergehenden Zustimmung entkoppeln sowie keine unmittelbare Grundlage für eine Aufhebung der Zustimmung unter Ausgleich eines etwaigen Vertrauensschadens entsprechend § 48 Abs. 3 VwVfG bieten (vgl. zum Vorrang der entsprechenden Anwendung der §§ 48 ff. VwVfG vor dem Rückgriff auf zivilrechtliche Regelungen ausdrücklich auch Kluth, a. a. O.). Systematisch spricht für dieses Verständnis außerdem, dass eine Zustimmung als behördeninterne Willenserklärung schwerlich stärker als ein Verwaltungsakt geschützt sein kann, sich dann vielmehr die Frage stellte, ob eine solche rechtswidrige Erklärung nach dem Grundsatz von der Rechtmäßigkeit der Verwaltung nicht ohnehin unwirksam ist. Es verbleibt daher bei dem o. a. Grundsatz zur Rücknehmbarkeit der Zustimmung, zumal in einem Vorbescheidsverfahren - wie vorliegend. Da der Vorhabenträger bei einem solchen ohnehin noch nicht mit seinen konkreten Planungen voranschreiten kann, sondern dafür in Form des Vorbescheides gerade eine Planungssicherheit sucht, wäre es erst recht unangemessen, die beteiligten Behörden in einem solchen besonders frühen Verfahrensstadium an eine selbst als rechtswidrig erkannte Entscheidung zu binden.
Ausgehend hiervon ist die Aufhebung (Rücknahme) der Zustimmung durch die Beigeladene zu 2) rechtmäßig erfolgt. Die vorhergehende interne Zustimmung des Luftfahrtamtes der Klägerin hatte (jedenfalls) die geplante Lage aller WEA in dem Flugbeschränkungsgebiets ED-R32 B um den Übungsplatz Munster-Nord entweder übersehen oder die sich dadurch für den militärischen Flug- bzw. Übungsbetrieb ergebenden o. a. Folgen falsch eingeschätzt. Ein schutzwürdiges Vertrauen auf den Bestand der Zustimmung hatte die Beigeladene zu 1) nicht. Ihr ist diese Erklärung des Luftfahrtamtes der Klägerin nach Aktenlage wohl bis heute nicht im Einzelnen bekannt, so dass sie schon deshalb nicht schutzwürdig darauf vertrauen durfte, die ihr aus dem vorherigen Schriftverkehr bekannten Bedenken der Bundeswehr hätten sich damit erledigt. Zudem war so selbst nach Übernahme durch die Beigeladene zu 2) und Weiterleitung an den Beklagten allenfalls der auf § 14 LuftVG bezogene Teil der Voranfrage insoweit positiv beantwortet, die darüber hinaus für den begehrten Vorbescheid jedenfalls erforderliche Zustimmung der Klägerin nach §§ 18a Abs. 1, 30 Abs. 2 LuftVG fehlte hingegen weiterhin. Sie wurde dann mit Schreiben vom 17. September 2019 an den Beklagten (für diesen bindend) versagt, aus dem sich zugleich auch die Gründe für die Fehlerhaftigkeit der vorhergehenden Stellungnahme zu den rein flugbetrieblichen Belangen ergaben. In keinem Zeitpunkt durfte die Beigeladene zu 1) demnach annehmen, ihr Vorhaben sei auch nur teilweise, d. h. bezogen auf die WEA 1 und 4, insgesamt luftverkehrsrechtlich zulässig.
Hat damit die Beigeladene zu 2) ihre Zustimmung nach § 14 LuftVG wegen unzureichender Berücksichtigung des andernfalls gestörten militärischen Flug- und Übungsbetriebs zu Recht zurückgenommen, fehlt es auch an dieser Zustimmung, ist der angegriffene Bescheid auch insoweit rechtwidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (vgl. nochmals o. a. Senatsurt. v. 13.11.2019, Rn. 67 ff.).
cc) Ob der Erteilung des Vorbescheides weitere der von der Klägerin (im Verwaltungsverfahren) geltend gemachten militärischen Gesichtspunkte, wie etwa die Lage am Rande des Interessengebiets der Luftverteidigungsradaranlage Visselhövede, entgegenstehen und welche Behörde hierüber zu entscheiden hat, bleibt offen.
dd) Anhaltspunkte dafür, dass sich in absehbarer Zukunft die zuletzt unter aa) und bb) angeführten Gründe, aus denen die Klägerin ihre Zustimmung versagt hat bzw. ihre Entscheidung negativ ausgefallen ist, beide ändern werden bzw. insoweit die Rechtslage zu Gunsten der Windenergie modifiziert wird, die o. a. Fehler also in einem ergänzenden Verfahren behoben werden können, bestehen insbesondere hinsichtlich der Störung des militärischen Flugbetriebs in dem Flugbeschränkungsgebiet nicht, so dass der Aufhebung des Vorbescheides auch nicht § 4 Abs. 1b, § 7 Abs. 5 UmwRG entgegenstehen.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1 und 3, 159, 161 Abs. 2, 162 Abs. 3 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1) waren danach niemand anderem aufzuerlegen, weil sie unterliegt und den Beklagten vorprozessual wesentlich zu der rechtswidrigen Teilabhilfe bestimmt hat; da die Beigeladene zu 2) keinen Antrag gestellt hat und damit nach § 154 Abs. 3 VwGO kein eigenes Kostenrisiko eingegangen ist, waren auch ihre Kosten nicht für erstattungsfähig zu erklären. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 709 Satz 2, 711 Satz 1 und 2 ZPO.
Gründe für die Zulassung der Revision gemäß § 132 Abs. 2 VwGO liegen nicht vor. Das Urteil beruht insbesondere nicht eigenständig tragend auf der - umstrittenen - Bejahung der Rücknehmbarkeit der Zustimmung nach § 14 LuftVG, so dass insoweit nicht die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gegeben sind.
