Landgericht Hildesheim
Beschl. v. 08.05.2023, Az.: 26 KLs 22 Js 43008/19
Strafrechtliches Verfahren wegen des Verdachts der Geldfälschung durch Herstellung und Vertrieb von Sammlermünzen und -medaillen
Bibliographie
- Gericht
- LG Hildesheim
- Datum
- 08.05.2023
- Aktenzeichen
- 26 KLs 22 Js 43008/19
- Entscheidungsform
- Beschluss
- Referenz
- WKRS 2023, 54534
- Entscheidungsname
- [keine Angabe]
- ECLI
- [keine Angabe]
Verfahrensgang
- nachfolgend
- OLG Celle - 07.08.2023 - AZ: 3 Ws 81/23
Rechtsgrundlage
- § 146 Abs. 1 StGB
Amtlicher Leitsatz
- 1.
Ob durch Herstellung und Vertrieb von Sammlermünzen und -medaillen der Tatbestand der Geldfälschung in Form des "Nachmachens" im Sinne von § 146 Abs. 1 StGB erfüllt wird, hängt von der Gestaltung der Metallstücke ab.
- 2.
Für die Frage, ob ein Nachmachen echten Geldes durch die Anfertigung von Sammlermünzen oder-medaillen gegeben ist, ist die Beachtung der Medaillenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 von Bedeutung.
In dem Strafverfahren gegen
1.A1.,
geboren
wohnhaft:
Verteidiger:Rechtsanwalt
2. A2,
geboren am
wohnhaft:
Verteidiger:Rechtsanwalt
3. A3.,
geboren am
wohnhaft:
Verteidiger:Rechtsanwalt
Nebenbeteiligte: A GmbH,
Vertreter:Rechtsanwalt
wegen: Verdachts der Geldfälschung
hat die große Strafkammer 16 des Landgerichts Hildesheim unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters am Landgericht Suden, des Richters am Landgericht Brennenstuhl und der Richterin am Landgericht Würfel am 08.05.2023 beschlossen:
Tenor:
Die Eröffnung des Hauptverfahrens wird abgelehnt.
Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeschuldigten fallen der Landeskasse zur Last.
Gründe
I.
Am 08.11.2019 erstattete das Bundesverwaltungsamt durch RD X Strafanzeige (Bl. 1 ff. Bd. I d.A.), auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, gegen die Angeschuldigten als Geschäftsführer der A GmbH wegen Geldfälschung. Das Bundesverwaltungsamt bringe - so die Anzeige - im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen die Gedenk- und Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr. Hierbei komme das Bundesverwaltungsamt häufiger mit den Vertreibern von Medaillen in Berührung, die ihre Produkte im Internet anbieten. Dem Bundesverwaltungsamt sei zur Kenntnis gekommen, dass auf der Internetseite der A, einem Münz- und Medaillenhändler, u. a. eine Medaille ("250. Geburtstag von Alexander von Humboldt") beworben werde, die einen Verstoß gegen § 146 Abs. 1 S. 1 StGB darstelle. Auch der Vertrieb anderer von der A angebotener Medaillen würde gegen § 146 StGB verstoßen.
Die in Rede stehende Medaille "250. Geburtstag von Alexander von Humboldt" hat folgendes Erscheinungsbild:
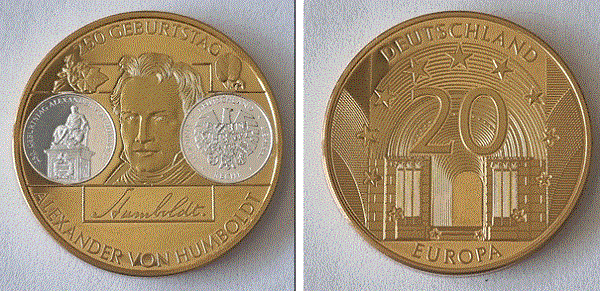
(Aufnahme des bei den Akten befindlichen Asservats, Durchmesser im Original: 40mm)
Hierzu vertritt das Bundesverwaltungsamt die Auffassung, dass eine Nachahmung eines echten Zahlungsmittels vorläge. Zwar sei die Medaille keiner konkreten Münze nachempfunden, so dass man sie mit dieser auch nicht verwechseln könne. Allerdings mache die Medaille durch die Zahl "20", das Portal im Hintergrund, das der Abbildung auf den Euro-Scheinen sehr ähnele, und den Aufprägungen "Deutschland" und "Europa" den Eindruck, dass ein Geldstück im Wert von 20 Euro vorliege. Auch würden die Medaillen für genau 20,00 € angeboten. Ein Laie, der nicht alle Gedenk- und Sammlermünzen auswendig kenne, könne leicht dazu verleitet werden, zu glauben, dass hier eine ihm unbekannte Münze vorliegt.
Nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens gegen die Angeschuldigten als Geschäftsführer der A meldeten sich mit Schriftsatz vom 17.01.2020 (Bl. 25 Bd. I ff.) Rechtsanwälte für die A und führten aus, dass es sich bei den der Anzeige zugrundeliegenden Medaillen nicht um (Falsch-)Geld handele. Die Medaillen halten - unstreitig - sämtliche Vorgaben der Medaillenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2182/20004 des Rates vom 06. Dezember 2004 über Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen, in vollem Umfang ein. Die Medaillen seien insbesondere nicht geeignet, von einem Arglosen mit echtem Geld verwechselt zu werden, weil sie sich bereits optisch und haptisch grundlegend sowohl von Euro-Umlaufmünzen als auch von Euro-Sammler-/Gedenkmünzen unterscheiden würden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Schriftsatz Bezug genommen.
In der Folgezeit führten die Vertreter der A und die Verteidiger der Angeschuldigten nach Akteneinsicht und das Bundesverwaltungsamt in zahlreichen, an die Staatsanwaltschaft gerichteten Schriftsätzen die gegenseitigen Rechtsansichten aus. Wegen der Einzelheiten wird auf die bei den Akten befindlichen Unterlagen (Für die A: Schriftsatz vom 29.06.2020, Bl. 82-112, und vom 08.07.2020, Bl. 120-165, Bd.I; für den Angeschuldigten A1: Schriftsatz vom 08.07.2020, Bl. 114-119; für den Angeschuldigten A2: Schriftsatz vom 13.07.2020, Bl. 167-168 Bd. I; für die Angeschuldigte A3: Schriftsatz vom 14.07.2020, Bl. 169-170; für das Bundesverwaltungsamt: Schreiben vom 11.02.2020, Bl. 47 Bd. I) Bezug genommen.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hildesheim am 19.08.2020 einen Durchsuchungsbeschluss für die Geschäftsräume der A. Auf den Durchsuchungsbericht der Polizeiinspektion G. vom 07.09.2020 (Bl. 182 Bd. I d.A.) wird Bezug genommen. Sichergestellt wurden u. a. Vertragsunterlagen mit dem Produzenten der Medaillen sowie Verkaufsunterlagen über erfolgte Absätze. Die in Rede stehenden Medaillen waren nicht mehr vorhanden.
Mit Verfügung vom 03.12.2021 (Bl. 24 Bd. II d. A.), die eine ausführliche Einschätzung der Sach- und Rechtslage enthält, hat die Staatsanwaltschaft das Bundesverwaltungsamt nach Nr. 90 RiStBV zur beabsichtigten Einstellung des Verfahrens gemäß § 170 Abs. 2 StPO angehört. Auf die Verfügung wird wegen der Einzelheiten Bezug genommen.
Auf das Schreiben des Bundesverwaltungsamts vom 04.02.2022 /Bl. 28 Bd. II d.A.), in dem die bereits mit der Anzeige vorgetragene Rechtsansicht wiederholt wird, ist die Staatsanwaltschaft von ihrem Einstellungsvorhaben abgerückt. Nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage kam sie unter Berücksichtigung einer Entscheidung des BGH (Urteil vom 27.09.1977,1 StR 374/77) zu einem von der bisherigen Einschätzung abweichenden Ergebnis.
Mit Verfügung vom 09.10.2022 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage vor der Kammer.
Die eingereichte Anklageschrift (Bl. 55 ff. Bd. II) wirft den Angeschuldigten vor, in der Zeit vom 07.11.2018 bis zum 03.09.2020 in XXX und andernorts gemeinschaftlich handelnd falsches Geld in der Absicht nachgemacht zu haben, dass es als echt in den Verkehr gebracht oder dass ein solches Inverkehrbringen ermöglicht wird, wobei sie gewerbsmäßig gehandelt haben sollen.
Konkret wird den Angeschuldigten zur Last gelegt, dass Mitarbeiter der A auf Anweisung der Angeschuldigten in der vorgenannten Zeit 750 Exemplare der von den Angeschuldigten oder den von ihnen weisungsabhängigen Mitarbeitern für die A in Auftrag gegebenen "Metallstücke" bei einer Produktionsfirma bestellt haben, die mit der von der A vorgegebenen Prägung des Designs "250. Geburtstag von Alexander vom Humboldt" versehen waren. Ebenfalls auf Anweisung der Angeschuldigten vertrieben Mitarbeiter der A diese "Metallstücke" in der Folge bis zum 03.09.2020 über die A an ihre Kunden. Die Medaille erwecke durch ihre optische Gestaltung den Eindruck, dass es sich bei ihr um von einer staatlichen Prägeanstalt herausgegebenes Münzgeld in Form einer Gedenk- und Sammlermünze handele, die im Zahlungsverkehr auch Zahlungsmittelfunktion erfülle. Den Angeschuldigten sei dabei jeweils die optische Gestaltung der Medaille bewusst gewesen. Ihnen sei es darauf angekommen, die Medaille in möglichst großer Stückzahl an ihre Kunden zu verkaufen. Durch den wiederholten Vertrieb haben sie sich eine dauerhafte Einnahmequelle erschließen wollen. Die Angeschuldigten hätten jeweils als Geschäftsführer der A gehandelt. Durch die Tat der Angeschuldigten sei die A bereichert worden, die daher als Nebenbeteiligte geführt wird und der gegenüber die Voraussetzungen der Verhängung einer Geldbuße nach § 30 OWiG vorlägen.
Nach Zustellung der Anklageschrift haben sich die Verteidiger der Angeschuldigten sowie die Vertreter der A jeweils - überwiegend gleichlautend zu den Erklärungen im Ermittlungsverfahren - erneut umfangreich schriftsätzlich geäußert (für die A: Schriftsatz vom 02.12.2022, Bl. 134-139 Bd. II; für den Angeschuldigten A1: Schriftsatz vom 30.11.2022, Bl. 117-133 Bd. II; für den Angeschuldigten A2: Schriftsätze vom 28.11.2022, Bl. 84-113, 30.11.2022, 115-116 Bd. II, 02.12.2022, Bl. 141-144; für die Angeschuldigte A3: Schriftsatz vom 02.12.2022, Bl. 145-152 Bd. II d.A.) und jeweils beantragt, die Eröffnung des Hauptverfahrens abzulehnen. Auf die schriftsätzlichen Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
II.
Die Voraussetzungen für die Eröffnung des Hauptverfahrens liegen nicht vor. Die Angeschuldigten sind der ihnen vorgeworfenen Tat aus tatsächlichen Gründen nicht hinreichend verdächtig.
1.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der in der Anklage dargestellte Sachverhalt nicht alle gesetzlichen Merkmale des angeklagten Tatbestandes enthält. Zu einem gemeinsamen Tatentschluss bzw. einem arbeitsteiligen Vorgehen der Angeschuldigten enthält die Anklage keine näheren Angaben. Ob und inwieweit dies für die Wirksamkeit der Anklage von Bedeutung ist, kann indessen dahinstehen, weil der erforderliche hinreichende Tatverdacht nicht gegeben ist.
2.
Hinreichender Tatverdacht ist dann zu bejahen, wenn die (allein) nach Maßgabe des Akteninhaltes (vgl. BayObLG NStZ 1983, 123) vorläufige Tatwertung ergibt, dass die Verurteilung der Angeschuldigten wahrscheinlich ist (vgl. BGH St 23, 304, 306). Die Wahrscheinlichkeit muss so groß sein, dass etwaige letzte Zweifel nur durch das Gericht in der Hauptverhandlung entschieden werden können. Das Gericht ist dabei gehalten, seine Beurteilung einerseits aufgrund des gesamten Ermittlungsergebnisses vorzunehmen, andererseits aber auch die besseren Aufklärungsmöglichkeiten in der Hauptverhandlung in Rechnung zu stellen (vgl. KG, Beschluss vom 01.12.1999, 1 AR 133/98 - 5 Ws 672/99, 1 AR 133/98, 5 Ws 672/99, zitiert nach juris). Wenn bei Anwendung dieser Maßstäbe bereits aufgrund des Akteninhaltes der Freispruch der Angeschuldigten wahrscheinlicher ist als ihre Verurteilung, ist das Hauptverfahren nicht zu eröffnen.
a.
Die in der Anklage beschriebenen und in diesem Beschluss bildlich wiedergegebenen Metallstücke mit der Prägung "250. Geburtstag von Alexander vom Humboldt" sind nach Ansicht der Kammer nicht geeignet, mit echtem Geld verwechselt zu werden.
Eine Strafbarkeit nach - wie angeklagt - § 146 Abs. 1 Nr. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter Geld "nachmacht", d. h. eine Sache mit dem Ergebnis körperlich behandelt, dass sie mit einer anderen Sache, die sie in Wirklichkeit nicht ist, verwechselt werden kann (RG 65 204, BGH 23 231). Geld ist dementsprechend nachgemacht, wenn es den Schein gültigen echten Geldes erregt und im gewöhnlichen Geldverkehr Arglose zu täuschen vermag (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, 30. Aufl. 2019, StGB § 146 Rn. 5). Nicht erforderlich ist, dass echtes Geld entsprechender Art im Umlauf ist. Wird der Anschein von Geld hervorgerufen, so kann ein Nachmachen selbst dann gegeben sein, wenn kein echtes Vorbild vorhanden ist (Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, 30. Aufl. 2019, StGB § 146 Rn. 5).
Vergleichsobjekt für die Frage, ob ein "Nachmachen" durch eine körperliche Behandlung vorliegt, ist also stets die Frage, in welchem Maße eine Übereinstimmung der behandelten Sache mit "echtem" Geld vorliegt, oder - wenn kein ansatzweise übereinstimmendes "echtes" Geld vorhanden ist - in welchem Maße durch die Verwendung von üblicherweise bei "echtem" Geld vorhandenen Merkmalen zumindest der Anschein echten Geldes erweckt werden soll.
Die Kammer schließt nach eigener, eingehender Betrachtung der im Original bei den Akten befindlichen Metallstücke aus, dass diese konkreten Medaillen von irgendjemandem für ein echtes Zahlungsmittel gehalten werden können.
(1)
Für die auslegungsbedürftige Frage, ob ein Nachmachen echten Geldes vorliegt, kann aus Sicht der Kammer in einem ersten Schritt auf spezifisch für den Markt der Sammelmünzen und -medaillen erlassene Verordnungen zurückgegriffen werden.
Hierzu ist festzustellen, dass die gefertigten Metallstücke mit der Prägung "250. Geburtstag von Alexander vom Humboldt" sämtlichen Voraussetzungen der Medaillenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 06.12.2004 über Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen geändert durch die VO (EG) Nr. 46/2009 des Rates vom 18.12.2008 entsprechen.
Rechtsgrundlage für die deutsche Medaillenverordnung ist § 10 des Münzgesetzes. Die Vorschrift lautet:
,,Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrates zu versagen oder unter Bedingungen zuzulassen, dass Medaillen und Münzstücke, bei denen die Gefahr einer Verwechselung mit deutschen Euro- Gedenkmünzen besteht, hergestellt, verkauft, eingeführt oder zum Verkauf oder anderen kommerziellen Zwecken verbreitet werden."
Daraus ergibt sich - worauf die Verteidigung nach Ansicht der Kammer zutreffend hinweist-, dass die Verordnung darauf gerichtet ist, die Gefahr einer Verwechselung auszuschließen. Erlaubt sind nach der Medaillenverordnung sowie den EU-Verordnungen nur Medaillen und Münzstücke, die ganz spezifische Vorgaben erfüllen und die vorliegend erfüllt werden. Die in den Verordnungen aufgeführten Merkmale hält der Verordnungsgeber offenbar für ausreichend, um die Gefahr einer Verwechslung auszuschließen und das jeweilige Prägestück zu erlauben.
Es liegt aus Sicht der Kammer jedenfalls nahe, dass bei Metallstücken, die den Vorgaben der Medaillenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 06.12.2004 über Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen entsprechen, deren Zweck die Verhinderung einer Verwechslung ist, indiziell kein Nachmachen im Sinne des § 146 StGB vorliegt, ohne dass den Verordnungen formal eine tatbestandsbeschränkende Funktion des Strafgesetzes zukommen kann. Der zuständige Verordnungsgeber - hier das Fachministerium - zeigt aber andererseits mit den Verordnungen diejenigen Merkmale auf, deren Vorliegen oder Abwesenheit für die Annahme einer Verwechslung von Bedeutung sind. Für die Frage der Auslegung des "Nachmachens" kann dies nicht bedeutungslos sein.
(2)
Auch die konkrete Prüfung der Gestaltung der Metallstücke ergibt kein anderes Ergebnis. Die Medaillen sind nach Aktenlage mit einem Durchmesser von 40 mm in etwa doppelt so groß wie 2-Euro-Münzen und sind um 1/3 größer als tatsächliche 20-Euro-Gedenkmünzen. Während die Euro-Umlauf-Münzen Gewichte von 2,3 g bis 8,5 g haben und die 20-Euro-Silbergedenkmünzen 18 g wiegen, sind die verfahrensgegenständlichen Medaillen mit 28 g mehr als dreimal so schwer wie Umlaufmünzen und fast doppelt so schwer wie 20-Euro-Silbergedenkmünzen.
Die Medaillen weisen unstreitig keinerlei optische Ähnlichkeit zu den Euro-Umlauf-Münzen auf. Das auf der Zahlseite im Hintergrund geprägte Portal findet weder auf den Euro-Umlauf-Münzen noch auf den von der Bundesrepublik Deutschland begebenen Sammler-/Gedenkmünzen Verwendung. Die Medaillen enthalten weder das "€"-Symbol noch das Wort "EURO", sondern allein die Zahl "20" und die Worte "Deutschland" und "Europa", die sich auf offiziellen Münzen nicht finden. Der auf dem "Kopf" der Medaille verwendete Adler ähnelt zwar dem Bundesadler, weist aber mit den eingeprägten Landeswappen auch Abweichungen auf. Zudem entspricht die Gestaltung mit zwei kleinen silberfarbenen Einlassungen in dem goldfarbenen Münzkörper keiner Gestaltung, die auf Umlauf-Münzen zu finden ist.
Schließlich tragen die verfahrensgegenständlichen Medaillen - anders als alle Euro-Umlaufmünzen und die von der Bundesrepublik Deutschland begebenen 20-Euro-Sammlermünzen - keine Randinschrift und keine Rändelung; sie sind glatt.
Die konkret in Rede stehenden Medaillen erwecken damit nicht den Anschein von echtem Geld. Auch (gerade) arglose Laien unterliegen aus Sicht der Kammer nicht der Gefahr, diese Metallstücke mit echten Zahlungsmitteln zu verwechseln. Im Gegenteil: Für die weitaus meisten Menschen dürfte der Umstand, dass es übergroße, mit Sonderprägungen versehene Metallstücke mit Zahlwerten von beispielsweise 10,- € gibt, die "echte" Zahlungsmittel sind, bereits für sich genommen überraschend sein. Laien würden daher - bereits aufgrund der Größe, der Farbe, der Gestaltung und des Aufdrucks "20" - nicht annehmen, dass es sich bei den Medaillen um echtes Geld handeln könnte. Sammler und Kenner des spezifischen Marktes hingegen, die Kenntnis über Sonderprägungen und abweichende Zahlwerte haben, würden aus Sicht der Kammer hingegen erkennen, dass den Medaillen offizielle Merkmale fehlen und es sich gerade nicht um echtes Geld handelt.
Der Umstand, dass die Medaillen auf der Website der A für 20,- Euro - und damit dem eingeprägten Zahlwerten entsprechend - zum Kauf angeboten wurden, kommt schließlich keine entscheidende Bedeutung zu.
Die Verwechslungsträchtigkeit muss sich aus dem Objekt selbst ergeben. Denn im gewöhnlichen Zahlungsverkehr werden weder der Verkaufspreis noch der Handelsname einer Medaille genannt. Wenn aber nicht die Beschaffenheit der "geldähnlichen" Sache - des Metallstücks, des Papierscheins - selbst die Verwechslungsgefahr begründet - wie hier aus Sicht der Kammer der Fall, siehe vor -, sondern die Art der Bewerbung, des Vertriebs oder der Bezeichnung die Verwechslungsgefahr dafür verantwortlich sein soll, meint die Kammer, dass die Anwendung von § 146 StGB ausgeschlossen ist, da die Täuschungseignung dann nicht mehr der jeweiligen Note oder Münze als solcher innewohnt.
b.
Aus Sicht der Kammer handelt es sich daher bei den in Rede stehenden Metallstücken bereits objektiv nicht um im Sinne des § 146 Abs. 1 Nr. 1 nachgemachtes Geld. Hierneben wird sich, selbst wenn der objektive Tatbestand erfüllt wäre, das Vorliegen des subjektiven Tatbestands nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachweisen lassen.
(1)
Der Täter muss wissen, dass er Geld nachmacht oder verfälscht, das geeignet ist, den Anschein echten Geldes oder eines höheren Wertes hervorzurufen. Bedingter Vorsatz genügt (BGH MDR/D 53, 596).
Bereits am Vorliegen auch nur bedingten Vorsatzes hinsichtlich des Nachmachens echten Geldes im Sinne des § 146 Abs.1 Nr. 1 StGB bestehen Zweifel. Nach unwidersprochen gebliebener Aktenlage haben sich die Angeschuldigten - als offenbar verantwortliche Geschäftsführer für die A, wobei die Anklageschrift die jeweiligen Funktionen, Verantwortungsbereiche, Aufgaben und konkreten subjektiven Vorstellungen, die Frage des gemeinsamen Tatplans wie auch des gemeinsamen Tatentschlusses offen lässt und sich auch den Akten keine entsprechenden Ermittlungen entnehmen lassen - bei der Gestaltung der Medaillen externen Rechtsrat durch Rechtsanwalt Dr. X, eingeholt. Dieser habe genau darauf geachtet, dass die A bei der Herausgabe und dem Vertrieb von Medaillen die gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der Regelungen der Medaillenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 einhält. Soweit es die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit von Medaillen anbelangt, habe Dr. X die A stets dahingehend beraten, dass bei Einhaltung der Bestimmungen und Vorgaben der Medaillenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 die Herstellung und der Vertrieb von Medaillen rechtlich ohne Weiteres zulässig ist. Rechtsanwalt Dr. X habe in seiner anwaltlichen Beratungstätigkeit für die A bei Einhaltung der entsprechenden Vorgaben zu keinem Zeitpunkt die Gefahr gesehen, dass der objektive Straftatbestand der Geldfälschung gemäß § 146 StGB erfüllt sein könnte (vgl. Schriftsatz RA X1, RA X2 für die A vom 29.06.2020, Bl. 82 (101 ff.), Bd. I d.A.). In der Akte befindet sich ein Schreiben des Rechtsanwalts Dr. X vom 17.06.2020, in dem dieser diese Angaben bestätigt (Bl. 111 Bd. I).
Anhaltspunkte dafür, dass die Angeschuldigten bei Unterstellung einer solchen Beratung durch einen externen Rechtsanwalt gleichwohl mit bedingtem Vorsatz davon ausgegangen sein sollen, mit der Herstellung der Medaillen bzw. der Beauftragung der Herstellung den objektiven Tatbestand des § 146 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu erfüllen, sind nicht ohne Weiteres ersichtlich und werden in der Anklageschrift auch nicht dargestellt.
(2)
Zudem - im Sinne eines Tatbestands mit überschießender Innentendenz - muss der Täter das Nachmachen in der Absicht vorgenommen haben, das Falschgeld als echt in den Verkehr gelangen zu lassen oder dies zu ermöglichen (BGH NStZ 13, 466 [BGH 20.03.2012 - 4 StR 561/11], NStZ-RR 13, 75 [BGH 20.09.2012 - 3 StR 140/12]; Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben, 30. Aufl. 2019, StGB § 146 Rn. 7).
Hierzu hat die Staatsanwaltschaft selbst in Ihrem Vermerk vom 03.12.2021 ausgeführt:
"Es ist zugunsten der Beschuldigten und ggf. der anderen an Herstellung und Vertrieb beteiligten Personen davon auszugehen, dass sie durch die Gestaltung der Medaille ähnlich einer Gedenkmünze die Attraktivität der Medaille erhöhen wollten, um den Absatz zu steigern. Dies gilt vor dem Hintergrund, dass sie die Medaille über ihren eigenen Webshop vertrieben haben, der sich an Münz- und/oder Medaillensammler richtet, weshalb die Beschuldigten davon ausgehen durften, dass den etwaigen Abnehmern die Medailleneigenschaft bewusst ist, weshalb die Medaille durch den Verkauf an die Kunden des Shops nicht als echt in den Verkehr gebracht wird. Auf eine Absicht der Beschuldigten, dass die Abnehmer die Medaillen dann später wiederum durch Weiterverkauf als Echtgeld in den Verkehr bringen, lässt sich hieraus ebenfalls nicht schließen. Die Medaille wird auch nicht als Münze oder Geld im Anzeigentext bezeichnet. Diese Umstände sprechen dafür, dass die Beschuldigten nicht die Absicht hatten, die Medaille als vermeintliches Echtgeld in den Verkehr zu bringen."
Dieser - später von der Staatsanwaltschaft nicht mehr vertretenen - zutreffenden Auffassung schließt sich die Kammer an.
Daran ändert auch die von der Staatsanwaltschaft nunmehr als maßgeblich angesehene Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 27. September 1977 1 StR 374/77, NJW 1977, 2364, 2365) nichts, da sie aus Sicht der Kammer nicht einschlägig ist.
Die Staatsanwaltschaft leitet aus der Entscheidung ab, dass für die Absicht des Inverkehrbringens genüge, dass ein beabsichtigter Verkauf an zum Beispiel einen Sammler diesen (bewusst) in die Lage versetzt, mit "falschem Geld" nach Belieben zu verfahren, mag er es selbst auch als Sammelobjekt erworben haben (zitiert in BGH, NJW 1977, 2364). Schon dies ist umstritten (s. insbesondere Erb in: Münchener Kommentar zum StGB, 4. Aufl. 2021, § 146 StGB, Rn. 26, der Konstellationen, in denen die Absicht des Täters lediglich dahingeht, dem Falschgeld durch die vorgespiegelte Echtheit einen Wert als Handelsware zu vermitteln, nicht als von § 146 StGB erfasst ansieht).
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatten die Angeklagten, die bei einer staatlichen Prägestätte angestellt waren, eigenmächtig falsche Münzen geprägt, um sie als Sammelobjekte zu einem dem Nennwert übersteigenden Preis an den Mann zu bringen. Die Angeklagten hatten also bewusst und zielgerichtet Sammlermünzen mit einem ausgewiesenen Nennwert produziert. In dieser Konstellation beseitige, so der BGH, allein die Eigenschaft als Sammelobjekte nicht die Gefahr einer Beeinträchtigung des allgemeinen Zahlungsverkehrs durch diese nachgemachten Sammlermünzen.
Anders als in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall liegt im dem hiesigen Fall nach Ansicht der Kammer jedoch gerade keine Nachahmung echter (Sammler-) Münzen - im Sinne von "falschem Geld" - vor. Es handelt sich vielmehr aus Sicht der Kammer um Phantasieprodukte.
3.
Nach alledem geht die Kammer nicht davon aus, dass mit den aus der Akte ersichtlichen Beweismitteln gegen einen der Angeschuldigten der erforderliche Tatnachweis zu führen ist. Die Eröffnung des Hauptverfahrens war daher aus tatsächlichen Gründen abzulehnen.
III.
Die Kosten- und Auslagenfolge ergibt sich aus § 467 Abs. 1 StPO.
